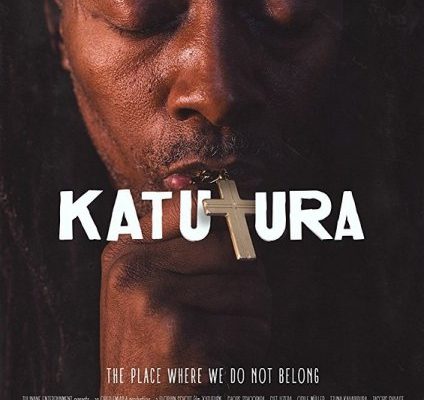Bezirk Rhein-Main
„Geparde auf dem Farmland in Namibia – Forschung zur Lösung eines langjährigen Konflikts“
Dienstag, 7. Mai 2024, 18 – 20 Uhr
Vortrag „Geparde auf dem Farmland in Namibia – Forschung zur Lösung eines langjährigen Konflikts“ von Dr. Jörg Melzheimer, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin.
In Kooperation mit dem Zoo Frankfurt gab es einen weiteren spannenden Vortrag über Namibias Fauna. Diesmal ging es um das schnellste Landtier der Erde – den Gepard, gleichzeitig auch die seltenste der großen Katzen. Ihr grösstes Vorkommen findet man in Namibia: Rund 50% aller Geparden leben hier und das nicht nur in den Naturschutzgebieten. Konflikte zwischen Menschen, ihren Nutztieren und Raubtieren sind ein weltweites Phänomen, und nachhaltige Lösungen zu entwickeln ist eine große Herausforderung, insbesondere für bedrohte Raubtierarten.
Dr. Jörg Melzheimer, seit 2005 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Evolutionäre Ökologie am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin wie auch Koordinator im Gepardenforschungsprojekt des Leibniz-IZW in Namibia und Experte im Fangen und Besendern von Tieren sowie in der Analyse der Bewegungsmuster, berichtete über seine langjährigen Untersuchungen zum Verhalten von Geparden und die dadurch gewonnenen Ergebnisse.
Geparden benötigen sehr große Streifgebiete, die mit bis zu 4000 qkm Fläche größer sind als die anderer Katzen. Der größte Teil der Population lebt auf kommerziell genutztem Farmland, was zu Konflikten führt, und zwar auf beiden Seiten. Es gibt Rinderfarmer, die 20 bis 30 Prozent ihrer Kälber an Geparde verlieren, was für sie ein echtes Problem darstellt, da die Nutztiere nicht nur Nahrung bedeuten, sondern auch Lebensgrundlage und Geld für die Ausbildung der Kinder. Daher bejagen einige von ihnen gezielt Geparden, obwohl sie auf der Roten Liste hoch gefährdeter Arten stehen und bedrohen so deren Population erheblich.
Dr. Melzheimer zeigt Fotos von Gepardenfellen, die ihm für wenig Geld angeboten worden sind, von Fallen, die es legal zu kaufen gibt sowie von eigentlich verbotenen Selbstschussanlagen an Zäunen. Es ist ein typischer Fall des Mensch-Wildtier-Konfliktes. Aber es gibt auch Lösungen, wie mit dieser Situation umgegangen werden kann. Und dabei bringen gute Kommunikation, Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis die Betroffenenen sehr viel weiter als verhärtete Fronten wie man sie häufig in Deutschland findet, erfahren wir von Herrn Melzheimer.
Eine typische Rinderfarm hat rund 3500 ha, wird natürlich im Wesentlichen genutzt für Rinder-Viehzucht, aber auch natürliche Wildtierarten kommen dort vor. Bei ihren Gesprächen haben Herr Dr. Melzheimer und sein Team im Großen und Ganzen zwei Gruppen von Menschen getroffen: Die eine hatte große Probleme durch die Raubkatzen, die andere wenige. Also haben sie nach Gründen hierfür gesucht und zwar mithilfe von „Embedded Research“, eingebetteter Forschung im Real-Labor.
Geparde anzutreffen ist schwierig und noch am ehesten möglich an ihren Markierungsbäumen, wo sie ihr Revier markieren. Diese Stellen, bzw. Bäume können zuverlässig bestimmt werden und waren daher auch für die Forscher essentiell, da sie dort ihre vollautomatische Fallen aufstellen konnten um die Tiere zu fangen und zu besendern. Mittlerweile, so teilt er mit, seien über 300 Geparde besendert, was wichtige Erkenntnisse lieferte: Diese Sammelpunkte oder auch Kommunikationszentren ziehen viele der ja eigentlich seltenen Katzen an. So beobachtete man ein erstes männliches kräftiges Tier, das das Territorium besetzt hatte und markierte. Sieben weitere Geparden kamen ohne zu markieren und zogen wieder weiter. Das territoriale starke Männchen markiert nicht nur und bleibt in einem bestimmten kleineren Streifgebiet. Es unterscheidet sich von den anderen auch dadurch, dass es viel kräftiger ist und sein Verhalten aggressiver und bestimmter, bzw. dominanter. Es hat den besten Zugang zu weiblichen Tieren und verteidigt sein Territorium normalerweise bis zum Tod. Nicht territoriale Männchen, auch „Rumstreicher“ (Floater) wurden ebenfalls besendert. Sie bewohnen größere Streifgebiete, markieren nicht und legen sehr weite Strecken zurück. Sie sind körperlich schwächer und verhalten sich zurückhaltender. Schafft ein Floater es aber ein Territorium zu übernehmen, wird auch er stärker, kräftiger und aggressiver.
Das Forscherteam erkannte, dass die Kommunikationszentren (Cheetah Hubs oder Hot Spots) in der Landschaft stabil waren und vermutete, dass dies mit dem Problem zu tun hatte, da sie sowohl von den territorialen wie auch den nicht territorialen Männchen und von den Weibchen für den Informationsaustausch genutzt wurden.
Die hohe lokale Dichte der Geparden bedeutet eine größere Gefahr für Nutztiere. Wissenschaftlich fundierte Lösungen waren gesucht, und die Farmer waren als direkte Partner in die Planung der Projekte eingebunden um in enger Zusammenarbeit sichere und unsichere Gebiete für die Mutterkuhherden zu identifizieren. 2008 wandten sich die Forscher an die Farmer mit dem Vorschlag die Mutterkuhherden umzusiedeln. Da die Farmen i.R. groß genug sind, hatten die Farmer die Möglichkeit auszuweichen und die Herden woanders zu platzieren – mit dem Ergebnis, dass die Hot Spots der Geparden geblieben sind. Die Raubkatzen sind nicht den Kälbern hinterher gezogen. In der Folge konnten die Verluste um rund 87% gesenkt werden und eine Art Risikokarte entstand. Forschung auf den Farmen war nun gefragt, man war nicht mehr Bittsteller. Hier haben Okonomie und Ökologie zusammen funktioniert, man hat das Problem durch gute Kommunikation lösen können. In dem Forschungsgebiet, das die Forscher ihr „Real-Labor“ nennen, konnten sie laut Dr. Melzheimer die Zahl der jährlich von Farmern geschossenen Geparde um etwa 80 bis 90 Prozent reduzieren. Bisher ist es nur eine Modellgegend etwa von der Größe Niedersachsens, aber diese Ergebnisse wolle und müsste man auch auf die anderen Landesteile ausweiten.
Beim anschließenden Fragen-und-Antworten-Teil ging es u.a. um Überlegungen, dieses Projekt auf andere Länder auszuweiten und um die Wiederansiedelung von Geparden. In Indien war einen Wiederansiedelung entgegen Prognosen versucht worden. Dies hat nicht funktioniert, da die Gebiete, bzw, Nationalparks zu klein waren. Auch in Gegenden, in denen bereits Geparden fest etabliert sind, mache dies keinen Sinn. Die Kommunikationszentren unattraktiv zu machen wie beispielsweise durch Absägen der Bäume würde nichts bringen, hören wir. Die Gegend sei es, die die Geparden interessierte, dort wo Treffen zwischen Männchen und Weibchen bestmöglich sind und die Kommunikation am Laufen halten bleibt. Entscheidend ist vor allem auch die Distanz zu den Nachbarn, also den nächsten territorialen Männchen.
Mutterkuhherden umzusiedeln funktioniert nicht überall, ist bei kleinen Farmen nicht möglich. Auch nach der Situation der Leoparden und ob dieses Konzept auch hier helfen könnte, wurde gefragt. In der Tat hatten sich auch namibische Farmer danach erkundigt und ein Leo-Projekt wurde gestartet. Bei Leoparden sei es aber komplexer, so Herr Melzheimer, und die Forschungen laufen noch. Das System bei Geparden sei etwas Besonderes und eher nicht zu übertragen, für jede Tierart sähe es anders aus. Leoparden geht es aber heute deutlich besser als vor etwa 15 Jahren. Das bedeutet aber auch mehr Konkurrenz für Geparden. Weibliche Geparden werden zwar auch getrackt, spielen aber für die Bewegungsmuster keine große Rolle, erfahren wir. Sie halten sich normalerweise zwischen den Zentren auf und sind nur dort, wenn sie sich vermehren wollen. Durch Weibchen verursachte Verluste seien tolerabel. Insgesamt könne man sagen, dass es ökonomisch sinnvoller ist den Geparden auszuweichen als sie zu töten.